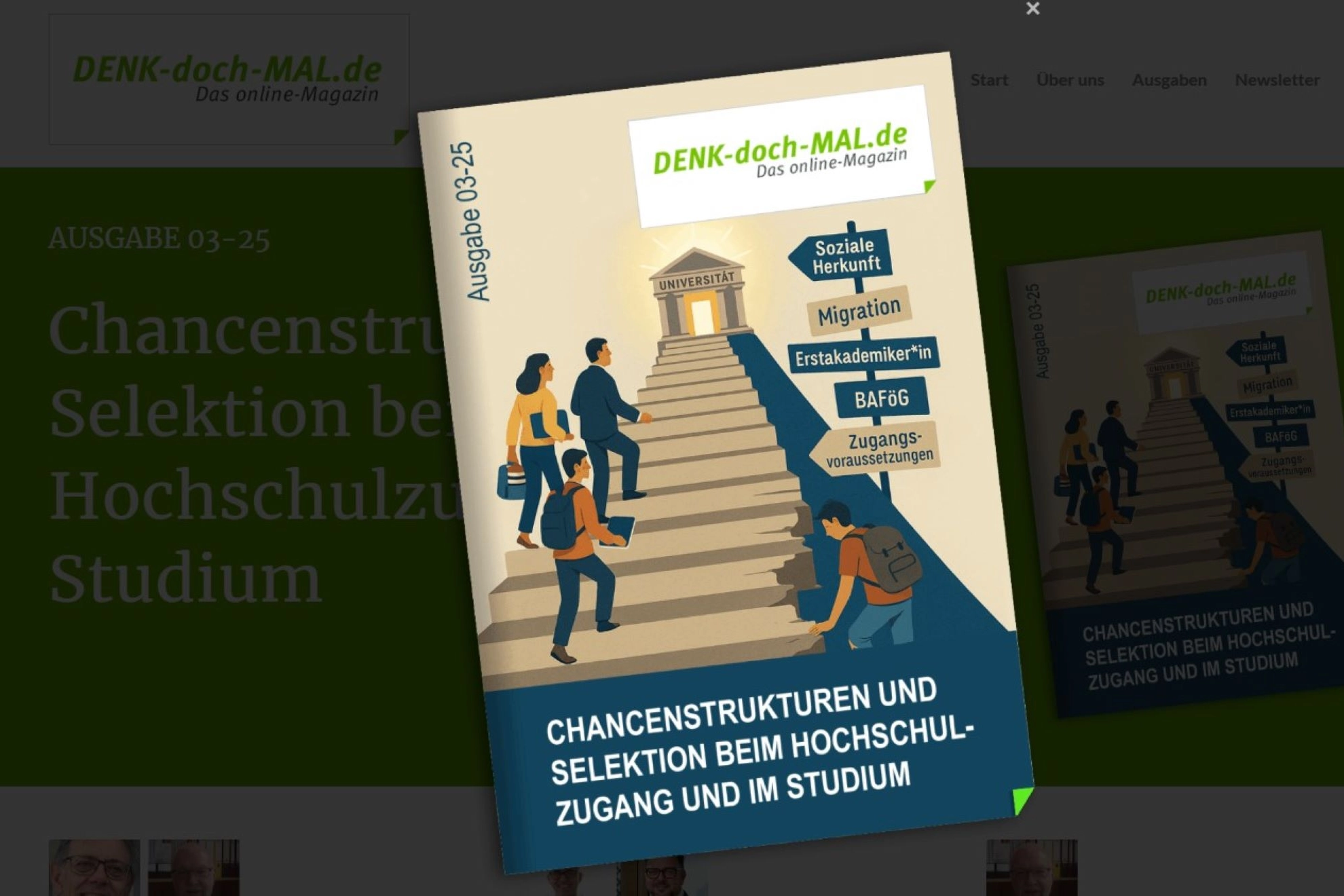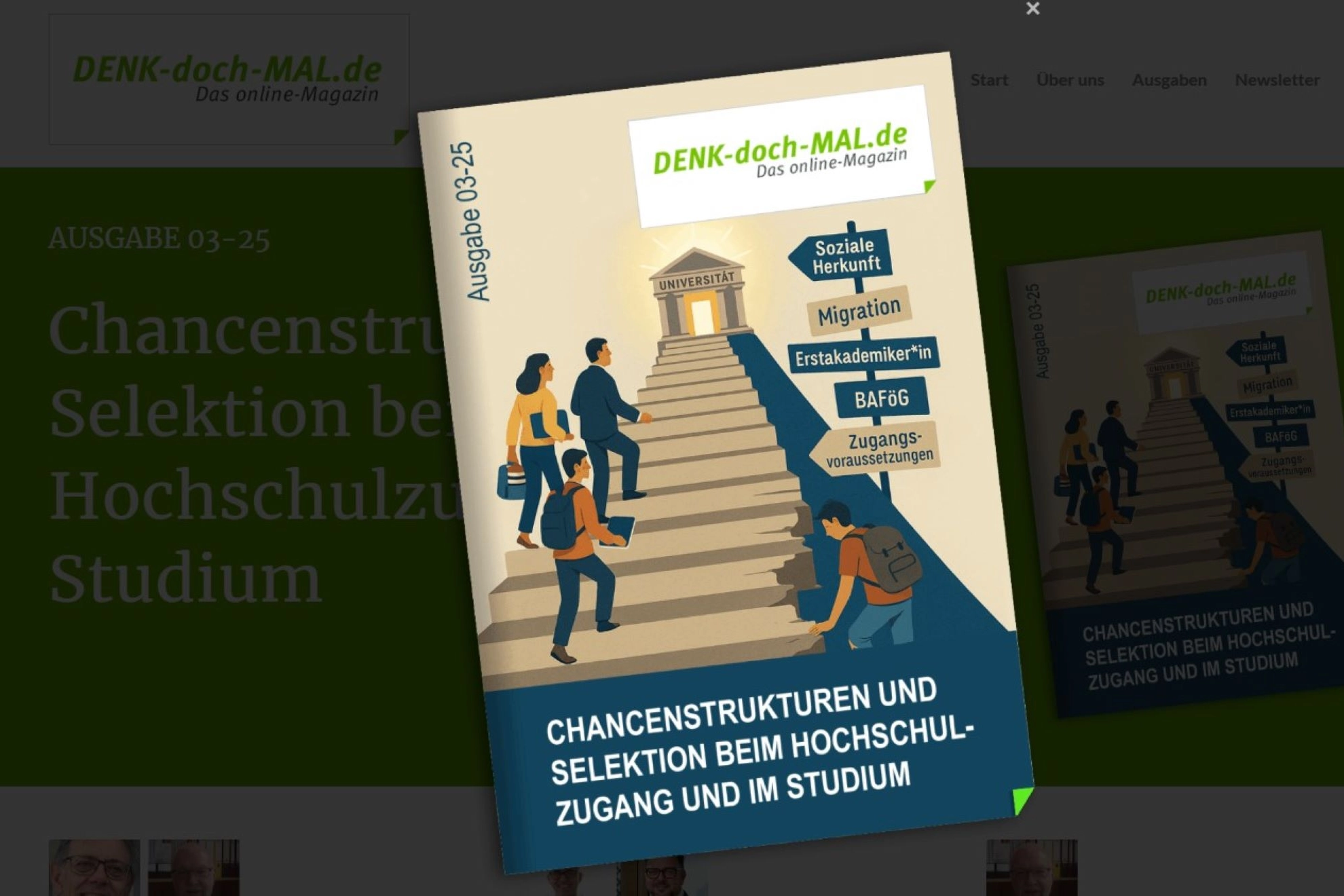Chancengleichheit beim Hochschulzugang ist auch im Jahr 2025 eine zentrale und in weiten Teilen ungelöste bildungspolitische Herausforderung. Kein Zweifel besteht daran, dass die soziale Struktur des Hochschulzugangs immer noch durch erhebliche soziale Schieflagen gekennzeichnet ist. Diese können heute aufgrund des methodologischen Fortschritts in der empirischen Bildungsforschung sehr viel präziser und differenzierter aufgezeigt werden als noch vor Jahrzehnten. Es bleibt als übergreifendes Gesamtbild, dass soziale Disparitäten
• alle Bildungsphasen im Lebensverlauf und alle institutionellen Sektoren im Bildungssystem, von der Grundschule bis zur Weiterbildung, deutlich, wenn auch in unterschiedlichen Mustern prägen;
• im Bildungssystem offensichtlich nur sehr langsam abgebaut werden, eher eine erklärungsbedürftige erstaunliche Kontinuität über alle gesellschaftlichen und politischen Veränderungen hinweg aufweisen;
• sich in unterschiedlichen Dimensionen darstellen - Bildungsherkunft, Migration, Geschlechtszugehörigkeit, regionale Herkunft - und sich diese Faktoren oft wechselseitig verstärken;
• dass sich frühere Ungleichheiten im Lebensverlauf, insbesondere an Übergangsstellen, z.B. von der Grundschule in die weiterführende Schule oder aus dem Schul- ins Hochschulsystem, in späteren Phasen fortpflanzen; soziale Selektivität wird dadurch biographisch kumulativ im Bildungssystem aufgebaut;
• dass die Population derjenigen, die ihre Schulzeit mit dem Erwerb einer Studienberechtigung abschließen und aus denen sich dann die Studienanfänger/-innen rekrutieren, eine bereits hochgradig nach sozialen Merkmalen vorgefilterte Gruppe bilden;
• dass die Schwelle des Hochschulzugangs und der Hochschulzulassung zwar auch einen sozial wirksamen Filter darstellt, der eigentliche Filterungsprozess aber nicht an dieser Stelle stattfindet, sondern sich über den ganzen vorangegangenen vorschulischen und schulischen Bildungsverlauf erstreckt und auch nicht bei der Studienaufnahme endet.
Die neue Ausgabe von DENK-doch-MAL untergliedert sich in zwei Schwerpunkte. Der erste enthält vier empirisch-analytisch orientierte Artikel zur Bedeutung der sozialen Herkunft für den Hochschulzugang und den Studienerfolg bzw. Studienabbruch, zur veränderten Zusammensetzung der Studierenden und zur Studienfinanzierung. Der zweite Teil umfasst vier mehr konzeptionell und bildungspolitisch fokussierte Beiträge zur Studienförderung, insbesondere zur Entwicklung des BAFöG, zum Selbstverständnis und zur Arbeit des Deutschen Studierendenwerkes, zur immateriellen Studienunterstützung durch das Netzwerk Arbeiterkind.de sowie zur Situation studentischer Hilfskräfte und den tarifpolitischen Initiativen zu deren Verbesserung.
Eine längere Hinführung zum Begründungszusammenhang dieser Ausgabe und zu den Inhalten der einzelnen Beiträge findet man im Editorial der Ausgabe.
Erwarten können Leserinnen und Leser profunde Beiträge zu folgenden Fragestellungen und Thematiken:
Markus Lörz und Kai Maaz befassen sich mit der „Illusion der Chancengleichheit auf dem Weg zur Hochschule“.
Andrä Wolter stellt sich dem Thema der Heterogenität unter den Studierenden.
Jessica Ordemann und Frauke Petra befassen sich auf der Basis der Studierendenbefragung 2021 mit den finanziellen Sorgen vieler Studierender und möglichen Lösungen, ihre finanzielle Situation zu verbessern.
Sören Isleib befasst sich mit der Bedeutung sozialer Faktoren für den Studienabbruchs.
Marvin Hopp und Ann-Kathrin Hoffmann greifen ein nicht minder relevantes Thema auf. Sie befassen sich mit den Möglichkeiten und Chancen der tarifpolitischen Absicherung der studentischen Beschäftigten.
Sonja Bolenius stellt Überlegungen zur Reform der staatlichen Studienförderung durch das BAföG vor.
Matthias Anbuhl befasst sich mit der Bedeutung der Studierendenwerke für die soziale Infrastruktur der Hochschulen und Studierenden.
Martina Kübler stellt uns Arbeiterkind.de vor und diskutiert deren Bedeutung für die Unterstützung der Studierenden der „ersten Generation“.
Die Beiträge verbinden Empirie, Analyse und bildungspolitische Praxis. Sie werfen die Frage auf, was angesichts der jeweiligen Problemstellungen und der vorliegenden Erfahrungen der Praxis sinnvoll getan werden kann, um die Situation der Studierenden zu verbessern und damit einen Beitrag für mehr Durchlässigkeit und soziale Chancengleichheit leisten. Wie ein roter Faden spannt sich durch die Beiträge hierbei der Gedanke, dass soziale Disparitäten nicht erst im Übergang zur Hochschule entstehen, sondern bereits in der frühen Kindheit in den in Kindergärten und Schulen angelegt ist.
Wie kann soziale Selektion im Bildungssystem abgebaut und eine größere soziale Durchlässigkeit erreicht werden? Offenkundig ist, dass nach wie vor das familiäre Bildungskapital die wichtigste „Ressource“ für den Bildungsweg ist, nicht zuletzt für die Aufnahme eines Studiums. Die Schulpolitik (auch für die Gewerkschaften) bekommt dadurch eine zentrale sozialpolitische Funktion. Was das z.B. für die Gewerkschaften bedeutet, ist angesichts anderer Schwerpunktsetzungen zu klären. Das Thema bleibt der bildungspolitischen Praxis wie einer an der Veränderung interessierten Forschung erhalten.
Wir wünschen uns und sind auch überzeugt, dass die aufgeworfenen Fragen eine hohe Aktualität haben und Impulse für Praxis wie Forschung geben können.
Abschließend gilt unser herzlicher Dank allen Autorinnen und Autoren, die für diese Ausgabe einen Beitrag verfasst haben – zeitaufwendig neben ihren hauptberuflichen Aufgaben. Wir hoffen, die Leserinnen und Leser dieser Ausgabe finden in diesen Beiträgen viele Anregungen, Informationen und Diskussionsanreize.
Hinweisen möchten wir auf die aus unserer Sicht wichtige Zusammenarbeit mit dem Repository des Bundesinstitutes für Berufsbildungsforschung, das dankenswerterweise alle Beiträge von DENK-doch-MAL übernimmt.
Unseren Leser*innen wünschen wir eine anrgende Lektüre. Hier geht es zur Ausgabe 03/2025 von Denk-doch-Mal.